Kernproblem bleibt ungelöst
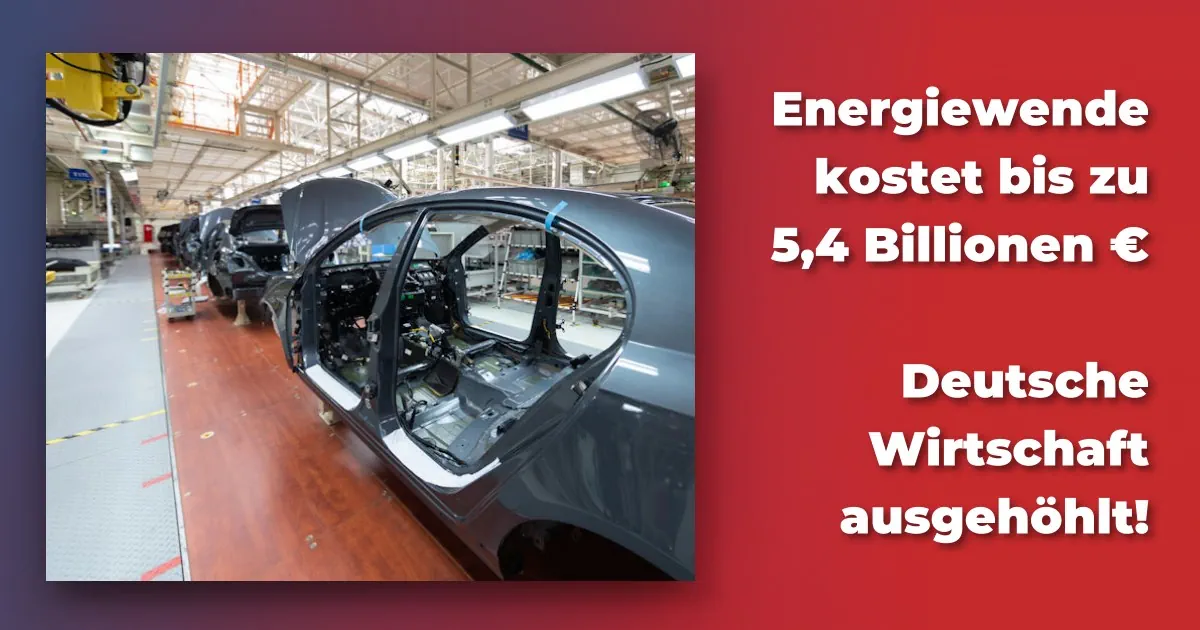
5,4 Billionen Euro für die Energiewende – und kein Ende in Sicht
DIHK-Studie zeigt Kostenlawine, doch das Kernproblem bleibt ungelöst
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat mit ihrer Studie „Neue Wege für die Energiewende – Plan B“ eine Diskussion ausgelöst, die weit über die Wirtschaft hinausreicht. Das Ergebnis ist alarmierend: Bleibt Deutschland auf seinem bisherigen Kurs, könnten sich die Gesamtkosten der Energiewende bis 2049 auf 5,4 Billionen Euro summieren. Das entspräche jährlich bis zu 316 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen – fast doppelt so viel wie heute.
Die Autoren der Studie (Frontier Economics) sehen die Wirtschaft an der Belastungsgrenze und empfehlen eine Kurskorrektur: weniger Regulierung, mehr Technologieoffenheit, internationale CO2-Bepreisung statt nationaler Alleingänge und eine Entlastung durch den Abbau überflüssiger Bürokratie.
Die DIHK selbst warnt, dass die „Lasten der Energiewende inzwischen eine Größenordnung erreicht haben, die nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, sondern auch Wohlstand und gesellschaftliche Akzeptanz gefährden“.
Analyse: Die wahren Ursachen bleiben ausgeklammert
Der Wirtschaftsjournalist Thomas Kolbe analysiert auf Apollo News, dass die Studie zwar die Kosten benennt, aber das eigentliche Kernproblem verschweigt: Deutschland steckt in einer selbst verschuldeten Energiekrise, deren politische Ursachen nicht offen ausgesprochen werden.
Kolbe beschreibt, dass die Industrieproduktion seit 2018 um rund 15 Prozent eingebrochen ist und die Lücke im realen Wachstum mittlerweile über 21 Prozent beträgt. Die Sozialsysteme geraten dadurch unter Druck – ein Effekt, der wesentlich auf die Energiepreise und die Abwanderung energieintensiver Branchen zurückzuführen ist.
„Was auf dem Papier nach Klimaschutz aussieht, bedeutet in der Praxis Abwanderung von Arbeitsplätzen, Kapital und technologischer Substanz“, schreibt Kolbe.
Die Energiewende sei zu einem „gigantischen Umverteilungs- und Kontrollprojekt“ geworden, das Wohlstand und Freiheit untergrabe, während die eigentlichen Ziele – sichere, bezahlbare Energie – verfehlt würden.
Seine Kritik trifft einen wunden Punkt: Selbst die DIHK hält an den politischen Dogmen von „Net Zero“ und CO2-Neutralität fest, ohne deren wissenschaftliche und ökonomische Grundlage zu hinterfragen. So bleibt der „Plan B“ nur eine kosmetische Korrektur innerhalb desselben Systems – ein Feigenblatt, das der Politik erlaubt, weiterzumachen wie bisher.
Kritik aus der Lobby der Erneuerbaren
Wenig überraschend reagierte der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) mit scharfer Ablehnung. Präsidentin Simone Peter warf der DIHK „unrealistische Annahmen“ vor und verteidigte die aktuelle Ausbaupolitik als Garant für „Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit“.
Der BEE kritisiert, das Szenario der DIHK würde auf fossile Importe und Wasserstoff setzen und den Ausbau von Wind und Solar drosseln. Das führe angeblich zu „neuen Abhängigkeiten“ und schwäche die „Resilienz des Landes“.
Diese Argumentation ist jedoch widersprüchlich: Gerade die Abhängigkeit von fluktuierender Wind- und Solarenergie, die nur durch massive Speicher- und Netzausbaukosten stabilisiert werden kann, hat Deutschland erst in die derzeitige Kosten- und Versorgungskrise geführt. Der Verweis auf Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung ändert nichts an der volkswirtschaftlichen Schieflage eines Systems, das ohne Dauerförderung nicht marktfähig ist.
Fazit: Kurswechsel oder Wohlstandsverlust
Die DIHK-Studie liefert belastbare Zahlen und benennt strukturelle Fehlentwicklungen, bleibt aber an der Oberfläche, weil sie die ideologische Grundlage der Energiewende nicht antastet.
Thomas Kolbes Analyse geht weiter: Sie zeigt, dass Deutschlands Wirtschaftsmodell – getragen von Industrie, Ingenieurskunst und bezahlbarer Energie – durch politische Übersteuerung ausgehöhlt wurde.
Die Reaktionen des BEE verdeutlichen, wie stark die Energiepolitik inzwischen von Partikularinteressen und Subventionsabhängigkeit bestimmt ist.
Wenn Deutschland seinen Standort sichern und soziale Stabilität erhalten will, braucht es mehr als einen „Plan B“ – es braucht Mut zu einem echten Neustart: Technologieoffenheit, marktwirtschaftliche Steuerung, und das Eingeständnis, dass der eingeschlagene Weg ökonomisch wie ökologisch in eine Sackgasse führt.
Titelbild: Montage mit Foto von freepik.com

